 |

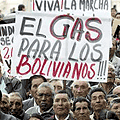
 |
 |
 |
Interview
mit dem Cocalero und
Abgeordneten Dionicio Núñez
Andreas Behn  16. Juni
2004 16. Juni
2004
Gespräch mit dem bolivianischen Abgeordneten und Repräsentanten der
Koka-Bauern, Dionicio Núñez. Er ist für die MAS (Movimiento
al Socialismo – Bewegung zum Sozialismus) Vizepräsident des bolivianischen
Parlaments. In dieser Funktion vertritt er gleichzeitig die Cocaleros aus der
Region Yungas rund 90 Kilometer nördlich von La Paz.
Nach heftigen Protesten verschiedener sozialer Bewegungen und blutiger Repression
im Oktober vergangenen Jahres musste der konservative, neoliberal ausgerichtete
Präsident Gonzalo Sanchez de Lozada zurücktreten und ins US-Exil fliehen.
Neben sozialen Forderungen richteten sich die Proteste vor allem gegen den geplanten
Export von bolivianischem Erdgas zu ungünstigen Konditionen über einen
chilenischen Hafen. Seitdem regiert Carlos Mesa als Übergangspräsident.
Wie hat sich die Lage in Bolivien im vergangenen halben Jahr entwickelt?
Das Jahr 2003 war für uns sehr wichtig. Zuerst kam es in Februar zu breiten
Protesten, die in den Aufstand im Oktober mündeten und mit dem Abtritt des
Präsidenten endeten. Danach ist die Lage im Land erst einmal ruhiger geworden.
Die verschieden Interessensgruppen versuchen, Einfluss auf die Regierung zu nehmen,
aber das spielt sich derzeit im Rahmen der demokratischen Spielregeln ab. Fraglos
hat der neue Präsident Carlos Mesa immer noch breite Unterstützung in
der Bevölkerung, offiziellen Umfragen zufolge um die 70 Prozent, viel im
Vergleich zu seinem Vorgänger, der kaum noch Unterstützung genoss.
Angesichts der schweren Wirtschaftskrise im Land fordern die unterschiedlichen
sozialen Sektoren vom Präsident, dass er Maßnahmen ergreift, um den
dramatischen Auswirkungen entgegenzusteuern. Bislang weigert sich Mesa, auf diese
Forderungen wirklich einzugehen. Das führt weiterhin zu Konflikten, beispielsweise
mit Gewerkschaften, mit streikenden Lehrern oder bei der Frage von Landverteilung
in einigen Regionen.
Doch insgesamt verhält sich die Mehrheit eher abwartend und schaut darauf,
wie die von der Regierung Mesa geplanten, demokratischen Entscheidungsprozesse
der kommenden Monate ausgehen werden: Dabei ist die wichtigste Frage, wie das
geplante Referendum ausgehen wird. Erstmals gibt es in Bolivien ein solches Referendum,
in dem im Juli über den Umgang mit dem bolivianischen Erdgas befunden werden
soll. Im Dezember dann finden Regionalwahlen statt, bei denen die Vertreter in
allen 317 Landesbezirken neu bestimmt werden. Und für kommendes Jahr ist
die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung vorgesehen, an der erstmals
auch Repräsentanten der sozialen Sektoren, der Indígenas und der Bauern
teilnehmen werden.
Ist bei dem Konflikt um das Erdgas ein Ende absehbar?
Hauptanlass der Protest im Herbst war der Plan, das bolivianische Gas an die USA
und Mexiko über einen chilenischen Hafen zu exportieren. Dies verkomplizierte
die Sache zusätzlich, weil Bolivien in einem früheren Krieg mit Chile
seinem Meerzugang verlor, was bis heute ein nationales Trauma darstellt. Insofern
ist die Abhaltung eines Referendums in den Augen der Bevölkerung eine positive
Entwicklung – zumindest ein erster Schritt, weil nicht mehr nur die Politiker
über eine so wichtige Frage befinden.
Nun gibt es natürlich Kräfte, die damit nicht einverstanden sind. Viele
konservative Sektoren, die die Linie der vorhergehenden Regierung und der transnationalen
Konzerne unterstützten, wollen diesen Wechsel nicht. Diese Kräfte tendieren
dazu, das demokratische Gefüge im Land zu destabilisieren.
Auch über die Formulierung der fünf Fragen im Referendum wird gestritten,
auch wenn inzwischen in wesentlichen Punkten eine Einigung gefunden wurde. Entscheidend
ist, dass nach dem Referendum ein neues Gesetz für den Umgang mit Erdgas
und anderen Rohstoffen ausgearbeitet werden wird. Die Mehrheit der Bevölkerung
will nicht, dass das Gas weiterhin so ausgebeutet wird bisher, oder wie das Silber
und andere Bodenschätze in früheren Zeiten. Die Erlöse vom Gasexport
sollen vielmehr zur Hebung des Lebensstandards aller Bolivianer verwendet werden.
Welche konkreten Forderungen vertritt die MAS in der Diskussion um das Erdgas?
Erstens: Die Bodenschätze müssen dem Land gehören und dürfen
nicht transnationalen Unternehmen übertragen werden. Zweitens: Rohstoffe,
an denen die Konzerne schon Rechte erworben haben, müssen zurückgewonnen
werden. Aber nicht mittels Nationalisierung, die als solche viele neue Probleme
schaffen würde. Deswegen wollen wir die bestehenden 78 Verträge aufheben
und prüfen, inwiefern die Konzerne wirklich ihren Verpflichtungen nachgekommen
sind. Drittens: Wenn wir die Rohstoffe zurückgewonnen haben, muss eine Industrialisierung
einsetzen, denn wir können nicht immer nur unverarbeitete Rohstoffe exportieren.
Also müssen wir das Gas und andere Rohstoffe selbst verarbeiten, um durch
den Export mehr einzunehmen.
Außerdem plädiert die MAS dafür, erst einmal alle Bolivianer,
von denen viele keinen Zugang zur Nutzung von Gas beispielsweise im Haushalt haben,
über diesen Rohstoff verfügen müssen. Erst der Überschuss
sollte exportiert werden. Und auch dies nur zu gerechten Preisen. Denn heute ist
es so, dass 82 Prozent der Gewinne, die mit dem Gasexport erzielt werden, in Händen
der Konzerne verbleiben. Dem bolivianischen Staat blieben gerade mal 18 Prozent,
es war also eher ein Geschenk an das Ausland. Dies muss geändert werden,
damit die Gas-Exporte in Zukunft dazu dienen, die Bedürfnisse der Bolivianer
zu befriedigen.
Bei der Formulierung des neuen Gesetzes im Parlament werden wir und andere sozialen
Sektoren also darauf drängen, dass der bolivianische Staat die volle Souveränität
über die Bodenschätze zurück erhält. Wir sind überzeugt,
dass unsere Forderungen auf diesem Weg voran gebracht werden können. Andere,
zum Beispiel die Führung des Gewerkschaftsverbandes COB (Central Obrera Boliviana),
sehen das anders und riefen im Mai zu einem unbefristeten Generalstreik auf. Der
ist allerdings kaum befolgt worden, weil die Bevölkerung offenbar auf den
mit der Regierung vereinbarten Prozess, auf das Referendum und die verfassungsgebende
Versammlung, baut.
Ist es nicht unrealistisch, von einem konservativ dominierten Parlament zu
erwarten, dass es ein fortschrittliches Gesetz zum Erdgas-Export entwirft?
Richtig, es ist eine Herausforderung, aber wir nehmen sie an. Wir haben es geschafft,
einen Präsidenten zu stürzen, aber die Macht in der Legislative wie
in der Justiz ist weiterhin in Händen der alten Regierungsmannschaft. Aber
wir setzen auf die Stärke der Zivilgesellschaft, die sich im Referendum ausdrücken
wird. Und da dieses Referendum verbindlich ist, wird auch ein konservatives Parlament
das neue Gesetz nicht aufhalten können. Noch hat die Bevölkerung nur
eingeschränkte Möglichkeiten, ihren Willen auszudrücken. Dies wird
sich bei den Kommunalwahlen Ende des Jahres und im Verfassungsprozess ändern.
In der Vergangenheit hat es schon zuviel Blutvergießen gegeben bei dem Versuch,
weittragende politische Veränderungen zu bewerkstelligen. Sie wurden immer
unterdrückt, zuerst durch eine lange Reihe von Militärdiktaturen, aber
auch später, im Rahmen der demokratischen Regierungen, ging die Politik der
Ausplünderung und des Ausverkaufs der bolivianischen Reichtümer an transnationale
Firmen weiter.
Sie sind also davon überzeugt, dass linke Kräfte bei den kommenden
Wahlen gewinnen werden?
Ja, wir sind fast sicher, dass es so kommen wird. Denn politische Parteien, die
40 oder 50 Jahre an der Macht waren oder sich an den vergangenen Regierungen beteiligt
haben, können kaum noch auf Unterstützung zählen. Alle politischen
Kräfte, die für die neoliberale Politik eintraten, die für den
Ausverkauf des Landes und die Massakrierung der Protestbewegung verantwortlich
waren, haben nach dem, was im Oktober passiert ist, ihre Unterstürzung verloren.
Das belegen auch viele unabhängige Umfragen. Also werden die alten aber auch
die neuen sozialen Akteure bei kommenden Wahlen erheblich besser abschneiden.
Wir sind überzeugt, dass die sozialen Bewegungen, die wie die MAS oder die
Indígena-Bewegung Pachakutik seit 2002 immer mehr Zulauf haben, in der
Lage sein werden, einen Transformationsprozess einzuleiten. Ähnlich den Veränderungen,
die in anderen Ländern wie Brasilien, Venezuela und anfänglich auch
in Ecuador bereits begonnen haben. Es zeigt sich, dass das neoliberale Modell
zumindest in Lateinamerika ausgelaufen ist und dass die sozialen Bewegungen, vor
allem die Indígena- und Bauernorganisationen, zunehmend an Einfluss gewinnen.
Es werden also neue Akteure in den Parlamenten sitzen, Menschen, die direkt aus
den sozialen Brennpunkten stammen, also keine Politiker mehr wie Ex-Präsident
Sánchez de Lozada, der besser englisch als spanisch sprach.
Hat die Protestbewegung seit dem Oktober-Aufstand – angesichts eines
konservativen Übergangs-Präsidenten, der sich großer Beliebtheit
erfreut – nicht an Schlagkraft verloren?
Es gibt Teile der breiten Bewegung, die versucht, die soziale Transformation in
Bolivien mittels ständiger Mobilisierung und Aktionismus zu erreichen. Aber
dabei handelt es sich um eine kleine Minderheit. Die große Mehrheit weiß,
dass die großen Veränderungen nur schrittweise zu erreichen sind. Wenn
also viele Gruppen und Aktivisten jetzt nicht den Aufrufen zum Generalstreik seitens
einiger extremistischer Gruppen gefolgt sind, zeigt dies keine Schwäche,
sondern dass sie dem demokratischen Prozess vertrauen. Denn in Bolivien ist die
Demokratie nicht von oben eingeführt worden, die Demokratie ist mit viel
Blut erkämpft worden, eben von den Aktivisten der sozialen Bewegungen –
insbesondere den Minenarbeitern, die in den 70er und 80er Jahren diesen Kampf
angeführt haben. Wir sind überzeugt, dass dieser Prozess weiterhin erfolgreich
sein wird, trotz aller Manipulation seitens der Medien und trotz allen Versuchen,
die Bewegungen zu diskreditieren und zu bedrohen.
Seit beispielsweise die MAS oder andere Organisationen solch große Bedeutung
erlangt haben, werden sie und ihre Sprecher Diffamierungskampagnen ausgesetzt,
als Drogenhändler oder als Terroristen bezeichnet. Insbesondere die Bewegung
der Kokabauern hat unter dieser Stigmatisierung zu leiden und viele ihrer Aktivisten
sind unter fadenscheinigen Begründungen inhaftiert. Die Machthaber werden
alles tun, um zu verhindern, dass die sozialen Bewegungen in Zukunft die Geschicke
dieses Landes bestimmen.
Hierbei werden sie tatkräftig von den USA und der US-Botschaft in La Paz
unterstützt. Für uns ist der jeweilige US-Botschafter immer der starke
Mann hinter dem Präsidenten. Unsere Präsidenten haben immer nur deren
Weisungen aus Washington ausgeführt, insbesondere bei dem Umgang mit dem
Koka-Anbau.
Trotz aller Anfeindungen vertrauen wir in die Kraft der Menschen in Bolivien,
in das Bewusstsein, dass die sozialen Bewegungen, die Bauern, die Cocaleros, die
Arbeitslosen, die Studenten oder die Indígenas geschaffen haben. Früher
hatten wir und all diese Gruppen keine Stimme im politischen Leben, immer haben
andere für uns gesprochen. Jetzt sind es die Bewegungen selbst, die für
sich sprechen. Und die enge Beziehung, die zwischen der Basis und ihren Sprechern
oder parlamentarischen Vertreten existiert, sowie die ständige Kontrolle
von unten macht diese neuen Akteure so erfolgreich.
In den Medien ist immer wieder von heftigen Streitigkeiten die Rede. Insbesondere
wirft der Indígena-Sprecher Felipe Quispe dem Aktivisten der Kokabauern
und MAS-Abgeordneten Evo Morales vor, mit der Regierung zu kungeln. Ist eine Spaltung
der Bewegung möglich?
Ja, es gibt Streit. Aber es muss beachtet werden, dass es in Bolivien eine Kampagne
gibt die versucht, jede Differenz innerhalb der Bewegungen in den Medien als Streit
aufzubauschen. Differenzen hat es immer gegeben, auch unter ihren Führern.
Zum Beispiel denken die marxistisch orientierten Sprecher der Minenarbeiter völlig
anders als wir aus der Cocalero- und Indígena-Bewegung. Genauso denken
linke Intellektuelle zumeist anders als die indigenen Führer. So hat es immer
schon Differenzen zwischen Quispe und Morales gegeben, nur dass dies nie ein Thema
in den Medien war. Dass ist jetzt anders, weil es Teil der Diffamierungsstrategie
ist.
Wichtig ist dabei aber, dass es diese Differenzen vor allem auf der Ebene der
Führungsgremien der verschiedenen Bewegungen gibt. Die unterschiedlichen
Sprecher von Organisationen oder Gruppen können sich streiten, aber wer schlussendlich
über die politischen Linien und darüber, ob sich Bewegungen spalten,
befindet, sind die Basen der einzelnen Bewegungen. Und ich glaube, dass die Basis
in allen bäuerlichen Bewegungen, sei es bei den Aymaras, den Quechuas und
anderen Indígenas, sowie die Aktivisten in den Städten genau wissen,
dass diese Differenzen vorüber gehen werden. Und in wichtigen Momenten oder
bei Wahlen werden wieder alle an einem Strang ziehen, genau wie bei dem Aufstand
im Oktober des vergangenen Jahres.
Ein zentraler Streitpunkt zwischen Regierung und sozialen Bewegungen ist der Umgang
mit dem Koka-Anbau, der insbesondere den USA ein Dorn im Auge ist. Wie ist derzeit
die Lage der Cocaleros in ihrer Region, den Yungas?
Seit Jahrtausenden wird in Bolivien Koka angebaut und als traditionelles Produkt
konsumiert. Zuerst wurde dieser Anbau unter den Militärdiktaturen der 80-erJahre
kriminalisiert. Dann wurde 1988 ein Gesetz erlassen, mit dem die Regulierung und
schließlich die Ausrottung des Kokaanbaus durchgesetzt werden sollte –
vor allem mittels Giftbesprühung, wie es derzeit auch in Kolumbien geschieht.
Als Reaktion auf dieses Vorgehen der Regierung und der US-Botschaft entstand die
Bewegung der Kokabauern. Weil die Cocaleros besonders brutaler Repression unter
Anleitung aus dem Ausland ausgesetzt waren, gewannen ihre Bewegung schnell an
Einfluss und war über die Landesgrenzen hinaus bekannt.
Bisher richteten sich die Aktionen der Regierung mehr auf die Region Chapare.
Jetzt geraten aber auch die Yungas ins Blickfeld. Deswegen haben wir eine internationale
Kampagne gestartet, in der wir darauf aufmerksam machen, dass in unserer Region
die gleiche Zerstörungspolitik nicht ein weiteres Mal angewendet werden darf.
Nicht nur weil hier die Aymaras schon seit Menschengedenken Koka pflanzen, weswegen
die Koka Teil der Landeskultur und -identität ist. Es geht uns um die Legalisierung
der Koka, was auch bedeutet, dass die industrialisierten Länder ihr Konzept
der Drogenpolitik verändern müssen. Denn die bisherige Anti-Drogenpolitik
hat in Ländern wie Bolivien, Peru oder Kolumbien gezeigt, dass sie völlig
sinnlos ist.
Nicht zuletzt geht es in dieser Kampagne auch um Souveränität, denn
die Politik von Mächten wie den USA in Bolivien ist in unserer Sicht auch
ein Angriff gegen die Indígena-Bevölkerung in den Anden, weil die
Koka Teil unseres Alltags und unserer Natur ist. Die Koka ist Teil der andinen
Kosmovision, sie ist Teil unserer Konzeption von Gegenseitigkeit und Solidarität.
Deswegen darf es einfach keine Vernichtungspolitik gegen die Koka geben. Natürlich
verurteilen wir den Drogenhandel, wir bestimmt mehr als die Organismen, die ihn
angeblich bekämpfen. Bei uns wurde die Koka traditionell nie zur Herstellung
von Drogen genutzt, das ist erst später von anderen Ländern eingeführt
worden, wodurch die Koka zu eine Rohstoff für Drogen wurde.
Welche Position hat Übergangspräsident Carlos Mesa in der Koka-Frage?
Die Regierung weiß sehr genau, wie stark die Cocalero-Bewegung in den vergangenen
Jahren geworden ist. Da es sich um eine recht schwache und zudem eine Übergangsregierung
handelt, hat sie stets Kontakt zu unserer Bewegung gesucht – ganz im Gegensatz
zu ihren Vorgängerinnen, die mit Gewalt die jeweiligen Vorgaben der US-Botschaft
umsetzten. Zudem weiß diese Regierung, dass ein eventueller Koka-Konflikt
in den Yungas sehr schnell auf das ganze Land übergreifen kann. Deswegen
existiert derzeit so etwas wie ein Waffenstillstand zwischen Regierung und Cocaleros.
Ein Zustand, über den sich die USA schon mehrfach in deutlichen Worten beschwert
hat. |
 |
 |