 |
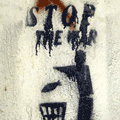

Niels Werber |
 |
 |
Die Campaign und der Gegner
Niels Werber  19. September
2001 19. September
2001
Wenn man nicht weiß, ob der Gegner als Feind oder Verbrecher ist, erklärt
man ihn zum Barbar. Nur Susan Sontag hat zu schreiben gewagt, dass es sich bei
den terroristischen Anschlägen auf New York und Washington weder um einen
Angriff auf die Zivilisation, die Menschlichkeit oder die freie Welt handele noch
um ein zweites Pearl Harbor. Doch dass sich „Amerika nun im Krieg befindet“,
hält sie für zutreffend. Europäische wie amerikanische Politiker
sprechen unisono von Krieg, Bush nennt die Anschläge den Auftakt zum ersten
Krieg dieses Jahrtausends. Die USA haben dem „Terrorismus den Krieg erklärt“,
und die Nato hat den Anschlag als „bewaffneten Angriff“ gemäß
Artikel fünf des Nato- Vertrages anerkannt. Auf Drängen der USA ist
1999 in das neue strategische Konzept des Bündnisses auch die Bekämpfung
des Terrorismus eingegangen. Der Aktionsradius der neuen Nato wird dort aber nicht
genau abgrenzt, womöglich, weil er nun keine Grenzen mehr hat. Wie sich ein
Mitgliedsstaat im Bündnisfall beteiligt, bleibt ihm allerdings selbst überlassen.
Interpreten des Vertrags halten „Art des Bündnisfalls, Art der Bündnisverpflichtungen,
Grad der militärischen Integration und geographische Reichweite“ für
unpräzise definiert (Johannes Varwick, Wichard Woyke, Die Zukunft der NATO,
Opladen 2000). Dies befähigt zweifellos zu großer Flexibilität.
Man kann zum Beispiel Hunderte von Marschflugkörpern abschießen und
Tausende von Bomben abwerfen, ohne einen Krieg führen zu müssen. Der
ehemalige Nato-Generalsekretär Solana erklärte zur Bombardierung Serbiens
kategorisch: „Dies ist kein Krieg, schon gleich keiner gegen das jugoslawische
Volk“. Vielmehr handele es sich um eine „Militäroperation gegen
Milosevic“. Man könnte sich also Maßnahmen gegen Osama bin Laden
vorstellen, die keinesfalls gegen das afghanische Volk gerichtet wären, selbst
wenn die Raketen oder Bomben auch seine Existenz als Volk bedrohten. Nunmehr aber
herrsche Krieg, wird immer wieder betont. Warum? Warum geht man nicht, wie im
Falle von terroristischen Anschlägen üblich, davon aus, es mit Verbrechern
zu tun zu haben? Der Attentäter von Oklahoma wurde vor Gericht gestellt,
überführt, verurteilt und hingerichtet. Carlos oder Terroristen der
RAF wurden mit internationalen Haftbefehlen gesucht, gefasst, verurteilt und bestraft.
Kein Staat, der von terroristischen Schlägen heimgesucht wurde, hat je den
Krieg ausgerufen. Die Regierung der Bundesrepublik hat selbst 1977, im Zustand
der Krise, vermieden, von Krieg zu sprechen, denn dies hätte zur Anerkennung
der RAF als feindlicher Armee geführt. Statt dem Anspruch der RAF nachzukommen,
als Kriegsgefangene im Sinne des Völkerrechts behandelt zu werden, wurde
immer wieder betont, sie seien Verbrecher. Und Verbrecher werden von der Polizei
verhaftet und von Gerichten verurteilt, nicht aber von der Armee „gejagt“
und in ihren „Löchern ausgeräuchert“. Sollte bin Laden für
die terroristischen Anschläge verantwortlich sein, müsste er dann nicht
als Verbrecher behandelt werden und das hieße zunächst einmal: als
Verdächtiger? „Jeder Mensch“, so lautet Artikel elf der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte, „der einer strafbaren Handlung beschuldigt
wird, ist so lange als unschuldig anzusehen, bis seine Schuld in einem öffentlichen
Verfahren, in dem alle für seine Verteidigung nötigen Voraussetzungen
gewährleistet waren, [...] nachgewiesen ist.“ Und ,jeder Mensch“,
so Artikel zehn, „hat in voller Gleichberechtigung Anspruch auf ein Verfahren
vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht“. Es sind genau diese
zivilisatorischen Standards, welche die amerikanischen und deutschen Botschaften
im Umgang den Taliban mit den inhaftierten Mitarbeitern von Shelter Now vermissen
und in zähen Verhandlungen sicherzustellen suchen. Kann eine „90-prozentige“
oder „ziemliche Sicherheit“ amerikanischer Geheimdienste darüber,
dass bin Laden schuldig sei, ein „öffentliches Verfahren“ vor
einem „unparteiischen Gericht“ ersetzen? Oder lässt die Art des
Angriffs, die hohe Zahl der Opfer und das Ausmaß der Zerstörungen nicht
zu, von einem Verbrechen auszugehen, weshalb es sich also um einen kriegerischen
Akt handeln müsse? Dem ließe sich entgegnen, dass gegen Serbien nie
Krieg geführt worden ist. Man hat den Begriff Krieg stets vermieden, im Nato-Vertrag,
auch in der UN-Charta ist immer nur von Maßnahmen die Rede, mit denen der
Friede wiederherzustellen sei. Dies hat den Vorzug, dass unerhörte Maßnahmen
möglich sind, ohne dass die Objekte dieser Maßnahmen jene Ansprüche
geltend machen könnten, die einer kriegführenden Partei gebühren.
Landkriegsordnung, Rot-Kreuz-Konvention etc. können ignoriert werden, da
kein Krieg herrscht, sondern nur einige Operationen durchgeführt werden,
etwa gegen Banditen, wie im Falle Tschetscheniens, oder gegen Milsosevic, wie
im Falle Serbiens. James Sheehan, der uns den Luftschlag gegen Serbien als humanitäre
Maßnahme verkauft hat, skizziert (siehe FR vom 18. September) die Form der
künftigen Sicherheitspolitik Europas entsprechend als Polizeiaktionen gegen
Banditen. Die USA wollen „Krieg gegen den Terrorismus“ führen.
Dies heißt aber offenbar nicht, dass sie bin Laden und seine Krieger als
Kombattanten in einem regulären Krieg behandeln wollen, denn dies würde
sie zu einem Feind aufwerten, mit dem nach Kriegsrecht verfahren werden muss.
Die USA bereiten aber keinen „gehegten Krieg“ des alten Völkerrechts
vor, sondern den ersten Feldzug des Dritten Jahrtausends. Der Gegner dieser „Campaign“
ist weder Feind noch Verbrecher, hat weder Anspruch auf einen fairen Prozess noch
auf einen Kampf nach Kriegsrecht. Der Gegner wohnt in „Löchern“,
haust in „Höhlen“, versteckt sich in „Unterschlüpfen“,
er steht außerhalb der Menschheit wie der Zivilisation, er repräsentiert
das Böse. Er ist also gar kein Mensch. Er ist ein Barbar, der „ausgeräuchert“
werden muss. Da man bin Laden weder als Verbrecher noch als Feind anerkennen will,
bietet sich Huntingtons Beschreibung globaler Konflikte als Clash of Civilizations
als Alternativsemantik an. Der Terminus fiel noch am Abend des 11. September,
Henry Kissinger verwandte ihn. In Huntingtons Szenario treten kulturell, ethnisch
und religiös definierte Großräume gegeneinander an, die sich im
Namen universeller Werte wechselseitig zu absoluten Feinden, zu Feinden der Menschheit
stilisieren. Im Iran sprach man vom Teufel USA, umgekehrt stellten die USA einzelne
Regionen „außerhalb der internationalen Ordnung und der zivilisierten
Welt“. Das binäre Schema lautet Zivilisation versus Barbarei. Um den
Krieg der Kulturkreise zu vermeiden, hat Huntington auf eine Überlegung Carl
Schmitts zurückgegriffen und den USA empfohlen, auf Interventionen in die
Räume anderer Kulturen zu verzichten. Dies ist nun fünf Jahre her und
man kann nicht sagen, dass sich die USA dieses Interventionsverbot für raumfremde
Mächte zueigen gemacht hätten. Was sie sich sehr wohl angeeignet haben,
ist die Semantik des Clashs, welche andere Regeln „gegenüber den Barbaren“
vorsieht als „gegenüber denen, die wie wir sind“. In diesem Unterschied
des zivilisatorischen Wir und dem extrazivilisatorischen Sie sieht Huntington
den Kern furchtbarer Konflikte, die daher so grausam sein können, weil der
andere nicht nach den eigenen Standards behandelt zu werden braucht. Auch der
Terrorangriff auf die USA funktioniert nach dieser Logik, denn der Islam und selbst
der heilige Krieg sehen keine Angriffe auf Zivilisten, Kinder und Frauen vor.
Also können es auch keine gewesen sein, sondern andere, gegen die solch ein
Angriff gerechtfertigt wäre. Die Eskalationsfähigkeit dieser teuflischen
Logik ist in jeder Hinsicht grenzenlos. Selbst wenn es im Westen nur um Rhetorik
handelte, muss darauf verzichtet werden, den Gegner hors la lois zu stellen und
als Unmenschen abzutun. Die NATO muss ihren Feind kennen, gewiss, und die USA
müssen die Urheber der verbrecherischen Attentate vor Gericht stellen, doch
aufeinen Kreuzzug im Namen der Menschlichkeit und der Zivilisation sollten sie
verzichten. Der Preis, den man zurzeit für höchste Werte zu zahlen bereit
ist, könnte sich als viel zu hoch erweisen. |
 |
 |