 |
 |
 |
 |
 |

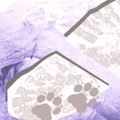

 |
 |
 |
Joschkas Klüngelbeutel
Christian Schmidt  in junge
Welt in junge
Welt  6. September 1998 6. September 1998
Über die Komplexität dieser Welt nicht nur als Wille und Vorstellung
Seltsame Koinzidenz. Gerade war Wir sind die Wahnsinnigen erschienen, da traf
ich auf der Straße einen alten Bekannten, dem ich wohl bald 20 Jahre nicht
mehr begegnet war. In der maoistischen Sekte, bei der auch ich zwischen meinem
sechzehnten und neunzehnten Lebensjahr gerne mitgelaufen war und u. a. die rote
Fahne der VR China tapfer geschwenkt hatte, war er einer der Eifrigsten gewesen.
Später hatte natürlich auch er zur grünen Partei gefunden, dort
irgendwie als „Ökolibertärer“ im Realolager mitgemischt,
um heute im sog. „Haus der Demokratie“ zu Berlin-Mitte „Runde
Tische“ mit Herrn Gauck, Frau Bohley, Herrn Thierse et. al. zu organisieren.
Wir kamen vor einem thailändischen Imbiss zu sitzen, und der alte Bekannte
erklärte mir gleich wieder die Welt. Dass es für uns an der Zeit sei,
gesellschaftliche Konflikte im Konsens zu lösen, nachdem doch der Konfrontationskurs
resp. Klassenkampf der letzten hundert Jahre nichts als Elend eingebracht habe.
Dass wir tunlichst nicht mehr das schlimme Wörtchen „Sozialismus“
in den Mund nehmen sollten, denn dieser Begriff sei mit Recht ähnlich diskreditiert
wie der Ruf des Medikaments Contergan. Und dass es nach den heute glücklicherweise
vorliegenden Erkenntnissen der Chaosforschung sehr fraglich sei, ob man gesellschaftliche
Prozesse überhaupt noch steuern könne: denn schließlich sei unsere
postmoderne Gesellschaft und Welt so überaus unübersichtlich und verdammt
komplex organisiert – oder doch eher gar nicht organisiert.
Das mag vielleicht so sein, wenn auch mir die Welt immer noch einigermaßen
schlicht eingerichtet zu sein scheint. So habe ich sie auch in meinem Buch beschrieben,
wo Cohn-Bendit, Fischer und Konsorten als Anführer einer Bande auftreten,
die Politik lediglich um des eigenen Vorteils willen betreiben, die Gelaber mit
Analyse verwechseln, die eine Politik propagieren, die sich auch nicht mehr in
Nuancen von denen der „Altparteien“ unterscheidet, und die sich damit
auf breiter Front in der grünen Partei durchsetzten. Wen wundert’s,
dass diese Sicht der Dinge Widerspruch hervorgerufen hat. Aber was macht die Welt?
Sie lässt einfach nicht locker, sondern tut alles, um mein Urteil zu bestätigen.
Zum Beispiel in der Gestalt des „Spiegel“-Redakteurs Reinhard Mohr.
Auch dieser Mann entstammt dem von mir beschriebenen Frankfurter Sponti-Klüngel.
Und er wird deshalb in meinem Buch gewissermaßen als Kronzeuge zitiert.
Wenn ich zum Beispiel schildere, wie Fischer und Co. sich 1982 aus purer lebensperspektivischer
Verzweiflung auf die Grünen stürzten, um dann diese Partei binnen kürzester
Zeit zu usurpieren, und wie sie dabei vom Zentralorgan der Frankfurter Spontis,
dem „Pflasterstrand“, massiv unterstützt wurden, dann stütze
ich mich u. a. auch auf einen zweiseitigen Leserbrief aus dieser Zeit –
von eben diesem Reinhard Mohr. „Eine letzte Hysterie“ nennt Herr Mohr
hier die realpolitische Wende der Spontis, geißelt kräftig „die
Penetranz“ des agitatorischen „Trommelfeuers“ des „Pflasterstrand“
für diese Wende, warnt vor den „Machtphantasien“ der „Sponti-Realpolitiker“
und prophezeit „nach intensiver Lektüre der Reisepläne“
sehr hellsichtig, dass die von Fischers Leuten angepeilte grüne Realpolitik
„ein grundjämmerliches Unternehmen sein wird“.
Allerdings verschweige ich in Wir sind die Wahnsinnigen auch nicht, dass Mohr
wenige Jahre nach dieser klaren Stellungnahme ebenfalls noch sein realpolitisches
Bekehrungserlebnis haben würde, „um dann“ – so steht’s
bei mir geschrieben – „als ‚Spiegel‘-Redakteur für
die Politik seines alten Stammes Reklame machen zu können“. Und als
ob er unter einem geheimen Zwang stünde, mein Verdikt mit noch mehr Inhalt
zu füllen, tut Mohr genau dieses prompt in einem „Spiegel“-Artikel,
der sich ausführlich mit meinem Buch beschäftigt.
Was mir Mohr in diesem Verriss im einzelnen vorwirft, ist durchweg unerheblich
oder mindestens ebenso amüsant wie der Umstand, dass der „Spiegel“-Redakteur
den Aussagen des Sponti-Mohr von 1982 hundertpro widerspricht. Interessanter ist
vielleicht die Tatsache, dass der „Spiegel“, unter dem Vorwand, Teile
meines Buches vorabdrucken zu dürfen, 10 000 Mark an den Econ-Verlag
überwies. Und dieses nur, damit mir Herr Mohr als erster ins Autoren-Stammbuch
schreiben durfte: „Bei ihm (also bei mir! C. S.) findet alles eine Erklärung,
und die unzähligen Widersprüchlichkeiten können immer wieder ins
gleiche Schema eingepasst werden. Für die Welt draußen, die sich jeden
Tag weiterentwickelt, für den lebendigen Widerstreit von Utopie, Hoffnung
und Desillusionierung, ist da kein Platz.“ Da ist sie also schon wieder,
die unglaubliche Komplexität der „Welt draußen“. Doch wie
sollte sie auch den ihr zustehenden Platz bei mir finden, wenn das, was das assoziierte
Fischer-Gang-Mitglied Reinhard Mohr zu seinem „Spiegel“-Verriss motiviert
hat, so offen zutage liegt, dass es selbst mir schlichtem Gemüt ein Leichtes
war, eben jenes in meinem Buch bereits vorherzusagen? Da sind die Experten gefragt.
Oder eine Expertin. Wie, nur mal als weiteres Beispiel, die just zur Kulturredaktionsleiterin
der „Badischen Zeitung“ ernannte Elisabeth Kiderlen. Auch sie findet
mein Buch nicht gut: „So einseitig und frei von jeder Widersprüchlichkeit
hat noch nicht einmal Bert Brecht in den späten Lehrstücken seine Charaktermasken
gezeichnet“. Machen wir’s in diesem Fall kurz: Auch Frau Kiderlen
stammt aus der Frankfurter Sponti-Szene. Und bekleidete sechs Jahre lang den Posten
einer hauptverantwortlichen Kulturredakteurin bei dem Blatt, das in meinem Buch
ordentlich sein Fett wegkriegt, nämlich dem „Pflasterstrand“.
Vielleicht noch jemand, der mir die Widersprüchlichkeit dieser Welt erklären
will? Schauen wir dazu noch fix in die August-Ausgabe der wegen ihrer vielen bunten
Anzeigen tatsächlich sehr unübersichtlichen Hamburger Illustrierten
„Max“. Hier trifft – o Schreck – auf zehn großen
Farbseiten die neue deutsche Schlagermutti Nena („99 Luftballons“)
den Mann, der ihr gefällt, „weil er mir – als einziger Politiker
überhaupt – ein Lebensgefühl vermittelt. Ganz abgesehen davon,
dass er als Mann sehr charmant und erotisch ist“. Gemeint ist die grüne
Spinatwachtel Joschka Fischer.
Die bzw. der ist durchaus in der Lage, das von Nena vorgegebene Niveau zu halten:
„Da hast Du völlig recht. Was Mozart an Hits produziert hat –
der wäre heute Millionär. Aber zurück zum Pop: In England gibt
es eine unglaublich kreative Pop-Szene. Warum stagniert sie bei uns?“ Auch
sonst erfährt man einiges von dem, was den Außenminister in spe offenbar
seit Jahren umtreibt: „Noch eine Frage an Dich, Nena. Ich habe lange über
das Phänomen Guildo Horn nachgedacht. Warum wurde der so schnell populär?“
Vielleicht, weil immer dann, wenn’s mit einem Gesellschaftssystem ökonomisch
und sozial rasant bergab geht, allgemeine Regression angesagt ist? Da will Herr
Fischer nicht hintanstehen. Nachdem ihm Frau Nena am Ende des „privaten
Gipfeltreffens“ („Max“) bereits „Ein bisschen Frieden“
vorgeträllert hat, wirft Joschka ein Schlagerstichwort nach dem anderen in
die Runde: „Ich kann mich noch an Gitte erinnern: ‚Ich will ’nen
Cowboy als Mann!‘“ Nena: „Einer meiner Lieblingsschlager! ...
Wenn du willst, sing ich den ...“ Fischer: „Freddy Quinn war in meiner
Kindheit sehr populär. ‚Seemann, lass das Träumen‘. ...
Und ‚Brennend heißer Wüstensand, fern, so fern, das Heimatland‘.
... Die Filme mit Freddy Quinn hab ich alle gesehen.“
Zeigt sich aber hier nun nicht ein angehender großer Staatsmann in seiner
ganzen Widersprüchlichkeit: Dort ernster politischer Denker, hie ganz Privat-
und Gagamann? Und haben wir hier nicht das beste Beispiel dafür, dass sich
die Verwirrnisse dieser Welt eben doch nicht auf bloßes Interesse und handfeste
Motive reduzieren lassen? Nun, ich würde das allzu gerne glauben, wenn wir
nicht gerade Wahlkampf hätten. Und das Gespräch Joschka – Nena
nicht ausgerechnet von einem Mann arrangiert worden wäre, der, von mir als
ideologischer Vor- und Nachbereiter der Fischer-Gang beschrieben, u. a. auch in
meinem Buch vorkommt: nämlich der ehemalige revolutionäre Kampfgenosse
von Joschka Fischer sowie zwischenzeitliche RAF-Bewunderer, der erst kürzlich
als stellvertretender Chefredakteur aus der Redaktion der „Hamburger Morgenpost“
ausgeschiedene und sogleich zum Chefkorrespondenten der ultrakomplexen Springerzeitung
„Die Welt“ beförderte – Thomas Schmid.
Noch Fragen? Ich nicht. |
 |
 |
 |
 |
 |
|