 |

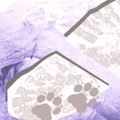

 |
 |
 |
Joseph Fischer und die Uno
Marc Kunz  29. September
1999 29. September
1999
Marsch durch die Institutionen
„Herr Präsident, diese Generalversammlung ist die letzte in diesem
‚Jahrhundert der Extreme‘, wie der britische Historiker Eric Hobsbawm
das zu Ende gehende 20. Jahrhundert genannt hat. Anlass genug für eine Standortbestimmung.“
So sprach der deutsche Außenminister Joseph Fischer vergangene Woche vor
der 54. Generalversammlung der Vereinten Nationen (Uno, von Fischer mit VN abgekürzt).
Da wird der marxistische Historiker zum Anlass für eine Bestimmung des Standorts,
da werden Kapitalismuskritik und Kapitalismus unfreiwillig vereint. Beides gilt
Fischer als Waffe für die weltweite Durchsetzung der „Ziele und Werte
der VN – Frieden, Menschenrechte, Freiheit, Gerechtigkeit und Entwicklung“.
Der deutsche Außenminister präsentierte sich als Sprecher eines Deutschlands,
dem es vor allem um die Abschaffung der Todesstrafe, des Kinderhandels und der
Diskriminierung von Frauen und um die unterdrückten Völker gehe. Die
Pressefreiheit müsse geschützt, ein „Ausgleich zwischen den reichen
und den armen Ländern zu Wege“ gebracht und die Zerstörung der
Umwelt gestoppt werden. Nachhaltig. Was für ein Kerl. Edel ist der Deutsche,
hilfreich und gut.
Und internationalistisch. Deswegen muss das Veto-Recht der ständigen Mitglieder
des Weltsicherheitsrates fallen, bzw. modifiziert werden. Denn das bisherige Vetorecht
für die festen fünf des zehnköpfigen Rates – die USA, Russland,
China, Großbritannien und Frankreich – „ist nicht nur wenig
demokratisch und transparent, es erleichtert auch die Einlegung des unilateralen
Vetos aus nationalen statt internationalen Interessen“.
Ohne Eigeninteresse ist der Deutsche auch. Deswegen muss auch ein ständiger
Sitz Deutschlands im UN-Sicherheitsrat her: „Wie Sie wissen, hat Deutschland
schon länger seine Bereitschaft erklärt, in diesem Zusammenhang dauerhaft
mehr Verantwortung zu übernehmen.“ So einfach wie der japanische Kollege,
der das gleiche will und zur Begründung anführte, Japan überweise
an die UN mehr Geld als vier der fünf ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat
zusammen, macht es sich Fischer nicht. Nur zur Verteidigung der Menschenrechte
wolle man die angestrebte Position nutzen.
Denn besonders ist der Deutsche Staatsfeind und Menschenrechtler: „Darf
den VN die Staatssouveränität wichtiger sein als der Schutz der Menschen
und ihrer Rechte?“ fragte Fischer das Plenum und wusste auch gleich die
Antwort: „Die Nichteinmischung in ‚innere Angelegenheiten’ darf
nicht länger als Schutzschild für Diktatoren und Mörder missbraucht
werden.“
Soviel Güte, Edelmut und Altruismus bleibt nicht unwidersprochen: US-Präsident
William Clinton erklärte, Entscheidungen über lebensrettende Interventionen
würden in erster Linie von nationalen Eigeninteressen bestimmt, nicht von
humanitären Prinzipien. Im Übrigen müssten sich die UN hin und
wieder auf Regionalmächte verlassen – wie auf die Nato auf dem Balkan,
Australien in Ost-Timor oder Nigeria in Westafrika.
Chinas Außenminister Tang Jiaxuan wandte sich lapidar gegen jede Schwächung
des Sicherheitsrates. Seine Rede war, glaubt man Reuters, der „Most-hard-line“-Einwand
gegen Rufe zur Anerkennung des Rechts auf „humanitäre Intervention“.
Auch der russische Außenminister Iwan Iwanow war deutlich: Die UN sollten
mehr Zeit darauf verwenden, gegen Separatisten „strenger vorzugehen“
und das Prinzip der staatlichen Souveränität zu stärken.
Und Algeriens Newcomer Abdelaziz Bouteflika wurde gar prinzipiell: Humanitäre
Einmischung in die Angelegenheiten eines anderen Staates sei erfunden worden,
um der jeweiligen Bevölkerung ihre nationale Souveränität zu nehmen.
Besonders perfide aber attackierte wieder einmal der Erzfeind – nicht direkt,
sondern über Le Monde. Die Zeitung schrieb zur Fischer-Rede: „Berlin
bestätigt so jeden Tag seinen Willen, eine diplomatische Großmacht
zu sein, die jedoch immer im Rahmen der internationalen Institutionen agiert,
handele es sich um die Vereinten Nationen, die Nato oder die Europäische
Union.“
Da hat sie Recht. Fischers Rolle ist die des Sunnyboys in den internationalen
Institutionen. Das hat seinen Grund: Deutschland kann seine Interessen nur mittels
dieser Einrichtungen verfolgen. |
 |
 |