 |
 |
 |
 |
 |

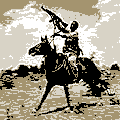 |
 |
 |
Der Krieg nach dem Krieg
Anton Holberg  junge Welt junge Welt  9.
Januar 2004 9.
Januar 2004
Sudan: Ölabkommen zwischen Regierung und SPLA-Guerilla. Neue Kämpfe
im westlichen Darfur
Ein für die Zukunft des Sudan „großer Durchbruch“,
so der kenianische Chefvermittler Lazaro Sumbeiywo am Mittwoch in Nairobi, sei
nach 20 Jahren Krieg erzielt worden. Die islamische Zentralregierung in Khartum
und die Guerilla der Sudan Volksbefreiungsarmee (SPLA) hatten sich auf die Verteilung
der Einnahmen aus der Förderung von Rohstoffen und auf die Einführung
einer neuen Währung geeinigt, und in der Tat scheint mit der Ölfrage
einer der seit 1983 zentralen Streitpunkte abgehakt: Es ging bei der im SPLA-dominierten
Südsudan konzentrierten Erdölförderung um etwa 250 000 Barrel
am Tag. Laut dem Abkommen werden während einer Übergangszeit von sechs
Jahren die Öleinnahmen im Verhältnis 50 zu 50 zwischen beiden Seiten
aufgeteilt. Danach soll die Bevölkerung im Süden über die weitere
Zugehörigkeit zu Sudan oder über die Bildung eines eigenen Staates
entscheiden.
Doch trügt der Schein eines bevorstehenden dauerhaften Friedens. Ungeachtet
aller Fortschritte in den Friedensverhandlungen stehen vor einem Ende dieses
Bürgerkrieges noch bedeutende Hürden, wozu vor allem die Fragen der
Machtverteilung in Khartum sowie die Zugehörigkeit der Regionen Abyei, Southern
Blue Nile und Nuba Mountains gehören.
Der bisherige Erfolg der SPLM ist es zwar, als militärisch stärkste
Repräsentantin der überwiegend christlichen Bevölkerung der Südprovinzen
die arabische und islamistische Regierung in Khartum durch den bewaffneten Kampf
an den Verhandlungstisch gezwungen zu haben. Doch ungeachtet dessen entstand
eine weitere militärische Front: Anfang vergangenen Jahres erklärte
der Rechtsanwalt Abdel Wahid Mohammad Ahmed Nour den Beginn des bewaffneten Kampfes
im Darfur, einer Provinz im Westen des Sudan. Dort hatten sich sowohl die wirtschaftliche
als auch die Sicherheitslage insbesondere seit den frühen neunziger Jahren
immer mehr zugespitzt.
Nachdem Mitte Dezember Gespräche zwischen Khartum und dem „Sudanese
Liberation Movement“ (SLM) zusammengebrochen waren, verhängte die
Regierung den Ausnahmezustand über die Region. Am vergangenen Samstag nun
erklärte SLM-Generalsekretär Minni Arcuo Minnawi gegenüber Reuters,
daß seine Organisation die Stadt Sherya 70 Kilometer östlich von Nyala
erobert und im zweistündigen Kampf 200 Regierungssoldaten getötet habe.
Regierungstruppen hätten ihrerseits 200 Zivilisten im Dorf Sorra umgebracht
und 4000 Bewohner aus sechs umliegenden Dörfern vertrieben.
Die SLM ebenso wie die zweite im Darfur aktive Rebellenbewegung namens „Justice
and Equality Movement“ (JEM) werfen der Zentralregierung vor, die schwarzafrikanischen
Ethnien der Region politisch und wirtschaftlich zu marginalisieren und sie den
Raubzügen und Überfällen arabischer Nomadenstämme nicht nur
auszusetzen, sondern diese sogar zu decken und zu unterstützen.
Im Darfur geht es nicht um Erdöl. Es geht hier auch nicht so sehr um die
insbesondere seit dem Machtantritt der „Nationalen Islamischen Front“ (NIF)
unter Hassan al-Turabi forcierte Unterwerfung aller Teile des Landes unter das
islamische Recht. Als Endpunkt einer von Ägypten ausgehenden transsaharanischen
Handelsstraße war der Darfur schon seit der Antike kulturell vielfältig
mit dem nördlichen Rand der Sahara verbunden. Die hier lebenden Ethnien,
vor allem die Fur und Masalit, sind seit längeren überwiegend Muslime,
und das Sultanat Darfur gehörte in vorkolonialer Zeit zu den bedeutendsten
afrikanischen Staaten des Sahel-Gürtels. Sprachlich haben diese Völker
allerdings ungeachtet der großen Unterschiede zwischen ihnen nichts mit
dem Arabischen zu tun. Vor allem aber leben sie überwiegend von der Landwirtschaft.
Dabei spielt sich der aktuelle Konflikt zwischen einer nicht-arabisch sprechenden
sesshaften Bevölkerung und arabischen nomadisierenden Viehzüchtern
ab. Diese unter dem Namen Juhayna bekannten Nomaden sind – ursprünglich
von der arabischen Halbinsel kommend – etwa im 19. Jahrhundert westlich
bis nach Bornou im Tschad vorgedrungen. Weder als Kamelnomaden (Abbala) noch
als Rindernomaden (Baggara) haben sie allerdings in der Region, darunter im Darfur,
in früheren Zeiten eine politische Rolle gespielt. Vielmehr waren sie Vasallen
der dortigen afrikanischen Könige bzw. Sultane, die noch bis 1916 herrschten,
und mussten ihren Tribut mit Vieh und Soldaten entrichten.
Im postkolonialen Staat Sudan hat sich dieses Verhältnis jedoch grundlegend
verändert. Insbesondere die von der NIF kontrollierte Regierung in Khartum
hat die traditionellen Stammesführer gezielt geschwächt und Teile ihrer
Ländereien an arabische Nomadenstämme gegeben. Die traditionelle Konkurrenz
von Bauern und Viehzüchtern um den Boden hatte sich in der Region im Zuge
der Sahel-Dürre und des Fortschreitens der Sahara nach Süden seit den
70er Jahren deutlich verschärft. Die Regierung in Khartum ergriff in dieser
Situation einseitig Partei für die arabische Seite. Inzwischen sind rund
eine Million Menschen von den Kriegshandlungen im Darfur unmittelbar betroffen.
Jenseits der Grenze, im Tschad, haben sich bereits 26 000 Flüchtlinge
aus dem Darfur eingefunden und benötigen dort dringend Nahrung, Wasser und
Kleidung. UN-Generalsekretär Kofi Annan warnte bereits vor „der sich
rapide verschlechternden humanitären Lage“ im Darfur und vor den verbreiteten Übergriffen
gegen Zivilisten, vor „Morden, Vergewaltigung und dem Niederbrennen und
Plündern ganzer Dörfer“. Die Regierung in Khartum spricht von „Stammesauseinandersetzungen“.
Im Januar 2003 setzte sie Bodentruppen und Luftwaffe im sich auf über 3000
Meter erhebenden Massiv des Jebel Marra ein und unterstützte nach Meinung
des UN-Sonderbeauftragten für humanitäre Angelegenheiten, Tom Eric
Vraalsen, arabische Milizen, die gegen die Zivilbevölkerung vorgehen.
Durch die Friedensverhandlungen von Nairobi zwischen Regierung und SPLM hat der
Bürgerkrieg im Darfur ebenfalls Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ob das
allerdings so bleibt, ist ungewiss. Schließlich geht es nicht wie im Südsudan
darum, dass westliche Konzerne zukünftig ungestört die sudanesischen
Erdölvorkommen ausbeuten können.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|