 |

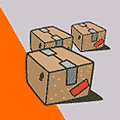 |
 |
 |
Monopoly
auf dem Wassermarkt (Teil 1)
Hermann Werle  MieterEcho MieterEcho
 14. Mai 2002 14. Mai 2002
Von Cochabamba bis Berlin
Zum Thema ‚Wasser‘ fällt uns hier in Deutschland zunächst
der viele Regen ein, der das Leben grau in grau erscheinen lässt. Einmal
im Jahr erscheint der Wasserverbrauch auch in der Betriebskostenabrechnung, ansonsten
hören wir etwas von Dürrekatastrophen auf dem afrikanischen Kontinent
oder Überschwemmungen in Asien. Das „blaue Gold“ hat sich jedoch
seit einigen Jahrzehnten zu einem internationalen Konfliktstoff entwickelt, der
die Vereinten Nationen 1977 veranlasste, die 80er Jahre zur „Internationalen
Trinkwasserdekade“ zu erklären. Und auch in Deutschland rückt
das Thema der Wasserversorgung zunehmend ins Blickfeld verschiedenster Interessen,
die sich auch auf die Qualität und den Preis unseres Wassers auswirken werden.
Die Versorgung mit Wasser gehört zu den elementaren menschlichen Bedürfnissen.
Neben dem direkten Konsum im Haushalt, verbraucht jeder Mensch indirekt große
Mengen Süßwasser. Der mit Abstand größte Wassernutzer ist
mit 69 bis 80 Prozent die landwirtschaftliche Produktion. Je höher der Anteil
an Bewässerungswirtschaft in regenarmen Regionen wie Indonesien oder nordafrikanischen
Ländern, umso höher ist folglich der Verbrauch. Der industrielle Verbrauch
beläuft sich im weltweiten Durchschnitt auf 23 Prozent. Hierbei ist die Differenz
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern enorm. Während erstere zwischen
60 und 80 Prozent verbrauchen, liegt der Anteil in den nicht industrialisierten
Ländern bei zehn bis 30 Prozent. Nach einem Bericht der UN-Kommission für
nachhaltige Entwicklung von 1997 lebt etwa ein Drittel der Weltbevölkerung
in Ländern mit mittlerem bis hohem Wasserstress, d.h. die entnommene Wassermenge
überschreitet 20 Prozent des gesamten erneuerbaren Süßwasservorrats.
Dies hat zur Folge, dass jährlich fünf Mio. Menschen, in der Mehrzahl
Kinder, an den Folgen mangelhafter Versorgung mir Süßwasser sterben
und ca. 80 Prozent der Erkrankungen in Wassermangelregionen auf verseuchtes Wasser
zurückzuführen sind.
Die „Internationale Trinkwasserdekade“ der 80er Jahre, die den Versorgungsgrad
der Weltbevölkerung auf 100 Prozent steigern sollte, ist völlig gescheitert.
Vor diesem Hintergrund haben die Vereinten Nationen in ihrer Millenniumserklärung
die Zielstellung erheblich heruntergeschraubt: Bis 2015 soll der Anteil der Weltbevölkerung,
der keinen Zugang zu sauberem Wasser hat, halbiert werden. Doch auch dieses Ziel
erscheint sehr hoch gesteckt, da die Wasserversorgung zunehmend privaten Investoren
überlassen wird, während staatliche Programme ausbleiben.
Wasseraufstand
in Cochabamba
Immer häufiger werden Konflikte durch das Lebenselexier geschürt, von
denen wir in Westeuropa selten etwas mitbekommen. Im April 2000 erlebte die 600 000
EinwohnerInnen zählende Stadt Cochabamba in Bolivien einen Wasseraufstand,
der vom Militär brutal niedergeschlagen wurde. Seit Mitte der 90er Jahre
hatte die Weltbank den weiteren Schuldenerlass für Bolivien an die Bedingung
der Privatisierung kommunaler Wasserbetriebe gekoppelt. Dem folgend hatte die
drittgrößte Stadt Boliviens, Cochabamba, 1999 mit dem transnationalen
Unternehmen Aguas del Tunari einen Vertrag über die Ver- und Entsorgung mit
Wasser abgeschlossen, der Preissteigerungen um bis zu 200 Prozent für die
Verbraucher nach sich ziehen sollte. Vom bolivianischen Staat wurde dem Unternehmen
zudem ein Profit von 15 Prozent garantiert, der sich über die erhöhten
Gebühren finanzieren sollte. Die Vehemenz und Brutalität der Niederschlagung
des Aufstands im April 2000 macht unmissverständlich klar, welche Bedeutung
der Deal mit dem Wasser für die bolivianische Regierung hatte und zu welchen
Mitteln sie bereit war, um der Garantie gegenüber dem transnationalen Unternehmen
zu entsprechen: Ausrufung des landesweiten Notstands, Einsatz von Militär,
sechs Tote, Hunderte von Verletzten auf Seiten der Protestierenden und Verhaftung
vieler Aktivisten.
Cochabamba ist kein Einzelfall: Gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds
(IWF) nimmt die Weltbank bei der Privatisierung und Restrukturierung im Wassersektor
eine Schlüsselstellung ein. Dabei gehen sie auf unterschiedlichen Ebenen
vor: Während der IWF im Rahmen von Strukturanpassungsmaßnahmen einen
Abbau von Subventionen und die Privatisierung staatlicher Unternehmen als Beitrag
zur gesamtwirtschaftlichen Stabilisierung fordert, setzt die Weltbank die Restrukturierung
in Sektorpolitiken und Projekten finanziell, verwaltungsmäßig und technisch
um. Perspektivisch sollen die Einnahmen aus dem Verkauf von Wasser und den Anschlussgebühren
nicht nur die laufenden Betriebskosten, sondern auch die Investitionen decken
(Vollkostendeckung). Die Einnahmen müssen darüber hinaus auch noch Zinsen
und Tilgung für die Kredite, mit denen die Investitionen vorfinanziert wurden
und die Gewinne des beteiligten privaten Unternehmens sichern. An diesem lukrativen
Geschäft haben auch deutsche Großkonzerne Interesse bekundet und rüsten
sich, unterstützt von Lobbyverbänden, Bankgesellschaften und politischen
Kräften, für den internationalen Wettbewerb.
Der deutsche Wassermarkt
Aus der Leitung fließendes Trinkwasser ist in der Bundesrepublik Deutschland
eine Selbstverständlichkeit und der Anschlussgrad liegt mit 98,6 Prozent
sehr hoch. Im Vergleich mit anderen Industrienationen ist die deutsche Wasserversorgung
jedoch sehr dezentral strukturiert: Wenigen großen Anbietern steht eine
Vielzahl kleiner, kommunaler Versorger gegenüber. Es existieren 6655 Wasserversorgungsunternehmen,
die insgesamt 17 849 Wasserwerke unterhalten, in Frankreich gibt es dahingegen
lediglich vier und in England zehn regionale und 14 lokale Wasserversorgungsunternehmen.
Auf eine Mio. EinwohnerInnen kommen in der BRD 88 Versorger, wohingegen es in
den Niederlanden 4,4 in England 0,7 und in Italien 2,3 sind. Bundesweit versorgen
etwa 4500 Unternehmen lediglich zwischen 50 und 3000 EinwohnerInnen. Über
80 Prozent der Wasserversorgungsunternehmen sind im Eigentum der Kommunen und
lediglich 1,6 Prozent befinden sich vollständig in privatem Eigentum. Diese
Zahlen machen deutlich, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser bislang
als Verantwortungsbereich des Gemeinwesens verstanden wurde. Die kommunale Versorgung
ist bislang durch ein rechtliches Instrumentarium abgesichert und somit wenig
privatwirtschaftlichen Interessen ausgesetzt. Der Paragraph 103 GWB (Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen) alte Fassung ermöglichte es den Kommunen
in der Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser, Konzessions- und Demarkationsverträge
mit einzelnen Unternehmen abzuschließen. Dadurch wurde lediglich einem Unternehmen
zeitlich befristet die Versorgung eines klar definierten Gebietes gestattet. Die
wettbewerbsrechtliche Sonderstellung wurde mit den hohen Kosten der bereitgestellten
Infrastruktur begründet und sicherte den Einfluss der Kommunen auf die Grundversorgung
mit Wasser. Für Strom und Gas sind zum 1. Januar 1999 die Gebietsmonopole
durch die Novellierung des Paragraph 103 GWB entfallen. Für Wasser jedoch nicht.
Ein weiteres Hemmnis für die Liberalisierung der Wasserversorgung stellt
der Art. 28 Abs. 2 GG dar, der das Recht der Selbstverwaltung von Städten
und Gemeinden im Bereich der Trinkwasserversorgung einschließt.
In den letzten Jahren verstärkt sich die Tendenz, private Investoren gemäß
Paragraph 103 GWB in die Wasserwirtschaft einzubinden. Dies geschieht in Form von
Minderheitsbeteiligungen an kommunalen Betrieben oder zeitlich befristeten Betreiberverträgen.
Diese Entwicklung ist dem Umstand angespannter Haushaltssituationen vieler Kommunen
geschuldet, die u.a. auf das verringerte Gewerbesteueraufkommen sowie erhöhter
Aufwendungen für Sozialhilfe zurückzuführen ist. Die großen
Konzerne nutzen konsequent die Schlupflöcher der rot-grünen Steuerreform,
die es ermöglichen, trotz Milliardengewinnen keine Gewerbesteuer zu zahlen.
„Um nicht noch mehr in die Schuldenfalle zu geraten, sehen sich die Kommunen
gezwungen, ihr letztes Tafelsilber zu verscherbeln bzw. zu privatisieren. Das
betrifft insbesondere öffentlich verwaltete Sektoren wie Wasser- und Energieversorgung
und den Personennahverkehr“, wie das Institut für sozial-ökologische
Wirtschaftsforschung (isw) in seiner Bilanz 2001 feststellt. Notwendige Investitionen
in die Wasserinfrastruktur sind vor diesem Hintergrund von den Kommunen nicht
mehr zu leisten. Die in den nächsten zwölf Jahren für die Sanierung
und Modernisierung der Anlagen erforderlichen Mittel belaufen sich laut Bundeswirtschaftsministerium
auf 200 bis 300 Milliarden Mark, wobei der Investitionsbedarf in der Abwasserentsorgung
den in der Wasserversorgung (z. Zt. rund fünf Milliarden Mark jährlich)
deutlich übersteigt. Für die zukünftige Entwicklung des deutschen
Wassermarktes wird es von maßgeblicher Bedeutung sein, ob der Paragraph 103
GWB in seiner alten Fassung für die Wasserversorgung erhalten bleibt bzw.
ob es für private Konzerne möglich sein wird, das Gesetz zu umgehen.
Deutscher
Bremsklotz
Der oben umrissene rechtliche Rahmen, der die Wasserversorgung als kommunale Verantwortlichkeit
mit kartellrechtlichen Auflagen festschreibt, steht im Zentrum der Kritik der
Privatisierungsbefürworter. In dem Bericht „Wasserwirtschaft im Zeichen
von Liberalisierung und Privatisierung“ der Deutschen Bank vom 25. August
2000 wird der Paragraph 103 GWB als entscheidendes Hindernis für die Marktöffnung
und damit der Entwicklung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit deutscher
Unternehmen dargestellt. Unter der Überschrift „Deutsches System: Bremsklotz
im Weltmarkt“ bemängelt die Bank die dezentrale Struktur der Versorgungsunternehmen,
die jedoch gerade der entscheidende Garant für die Versorgungssicherheit
mit hochwertigem Trinkwasser der Menschen darstellt. Aber die Deutsche Bank verfolgt
andere Ziele und sieht sich in der Rolle des Kreditgebers für Großprojekte
auf den internationalen Wassermärkten, wo es ihrer Einschätzung nach
um ein jährliches Umsatzvolumen von rund 300 Milliarden US-Dollar geht und
es für deutsche Anbieter noch nicht zu spät sei: „Kooperationen
auch über die Ländergrenzen hinaus könnten hierbei die Chancen
verbessern, am Wachstum der internationalen Wasserwirtschaft zu partizipieren.“
Deutsche Giganten
Die Deutsche Bank braucht sich indes keine allzu großen Sorgen zu machen,
denn ihre deutschen Großkunden sind keineswegs zurückhaltend. Der E.on-Konzern,
der im Jahr 2000 aus der Fusion von Veba und Viag entstanden war, plant den britisch-amerikanischen
Stromversorger Powergen und den größten deutschen Gaskonzern Ruhrgas
zu übernehmen. Das Tochterunternehmen E.on-Aqua hält über 80 Prozent
an Gelsenwasser, dem bislang größten Wasserversorger Deutschlands.
Einzig die Essener Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke (RWE)
könnten E.on-Gelsenwasser diesen Rang ablaufen. Beide Konzerne verfahren
nach dem ‚Multi-Utility-Konzept‘ (siehe Anhang).
Der RWE-Konzern hat vor zwei Jahren mit dem britischen Unternehmen Thames Water
und dem US-amerikanischen American Water Works zwei international tätige
Großunternehmen für über zwölf Milliarden Euro übernommen.
Im Dezember 2001 schluckte der Konzern zusätzlich Transgas aus der Tschechischen
Republik und vor wenigen Wochen den britischen Strom-Marktführer Innogy.
Mit diesen Einkäufen ist RWE zweitgrößter Stromproduzent Europas
und drittgrößter Wasserversorger weltweit. Vor ihm liegen in dieser
Sparte lediglich die zwei französischen Unternehmen Suez und Vivendi. Wasser
ist damit zur profitabelsten Sparte des Essener Konzerns geworden, der im Ruhrgebiet
derzeit mit E.on um die Wasser-Vorherrschaft streitet (siehe Anhang).
Englische
Verhältnisse
Wenn es einen Aspekt gibt, an dem sich Liberalisierungsbefürworter und -gegner
einig sind, so ist das derjenige, dass die Wasserversorgung in Deutschland im
weltweiten Maßstab einen Spitzenplatz einnimmt. Sowohl von der Wasserqualität
und dem Anschlussgrad als auch den geringen Durchleitungsverlusten. Aus dieser
Perspektive gibt es also keinerlei Anlass, an den bestehenden Strukturen etwas
zu verändern. Zu befürchten sind bei zunehmender Privatisierung der
Wasserwirtschaft hingegen Zustände wie in England. Dort wurde die Wasserversorgung
und die Abwasserentsorgung 1989 vollständig privatisiert mit dem Ergebnis,
dass seither die Gewinne um das Zweieinhalbfache und die Direktoren- und Managementgehälter
um das Viereinhalbfache gestiegen sind. Gleichzeitig haben sich die Verbraucherpreise
nahezu verdoppelt und 12 500 Haushalten wurde allein im Jahr 2001 das Wasser
abgestellt. Dass die Preise auf liberalisierten Märkten nicht zwangsläufig
und schon gar nicht auf Dauer sinken und auf niedrigem Niveau bleiben müssen,
erklärte der E.on Konzernchef Ulrich Hartmann vor wenigen Wochen. So sollen
die Strompreise in diesem Jahr um zehn Prozent steigen, da die Stromerzeugung
nicht Kosten deckend sei. „Damit dürfte in Deutschland der durch
die Liberalisierung des Strommarktes vor knapp vier Jahren eingeleitete Strompreisverfall
wohl endgültig vorbei sein. Die Trendwende sei bereits Mitte vergangenen
Jahres geschafft worden“, sagte Hartmann laut der Berliner Zeitung vom
22. März 2002.
Anhang
Multi-Utility
Multi-Utility bezeichnet die umfassende Versorgung mit leitungs- bzw. netzgebundenen
Gütern, d.h. die Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser aus einer Hand.
Auf Grund einheitlicher Abrechnungssysteme beim Service und bei der Wartung
sowie durch Neubau von Infrastruktur in Form kombinierter Rohrleitungen, entstehen
für
Großkonzerne dieser Sparte Synergien, die kostendämpfend wirken und
enorme Gewinnspannen versprechen. Multi-Utility wird durch diesen Effekt sowohl
national als auch international als Wachstumsmarkt eingeschätzt. E.on und
RWE sind die deutschen Multi-Utility-Giganten, die von den Marktanteilen und
vom Umsatz her im internationalen Vergleich auf den vorderen Plätze landen.
 zurück zurück
Ruhrgebietsklüngel
E.on und RWE sind die beiden Kontrahenten des derzeitigen Kampfs um die Rhei-
nisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW), der mit einer Mio. KundInnen
eine Schlüsselposition im Ruhrgebiet zugeschrieben wird. Als im letzten
Jahr Anteile der RWW zum Verkauf angeboten wurden, gab es zunächst sieben
Interessenten, von denen sehr schnell nur noch zwei übrig geblieben waren:
RWE und E.on-Gelsenwasser. Durch ein „arithmetisches Mysterium“,
wie es im Manager-Magazin genannt wurde, hatten beide Konzerne exakt den gleichen
Preis von 228 Millionen Mark geboten. Doch bei diesem Mysterium sollte es nicht
bleiben: Aus nicht ersichtlichen Gründen
entschied sich der Mühlheimer Stadtrat im September 2001 dazu, nur noch
mit RWE weiter zu verhandeln. Gelsenwasser vermutete dahinter den „klassischen
Ruhrgebietsklüngel“ und auch BürgerInneninitiativen baten den
Mühlheimer Rat um Aufklärung dieser Vorgänge. Auf eine aufschlussreiche
Erklärung warten sie bis heute. An Stelle dessen wurde auf der Ratssitzung
vom 14. März 2002 der Verkauf der RWW-Anteile an RWE beschlossen. Der Vertrag
soll Ende April in der Schweiz unterzeichnet werden und beinhaltet, dass der
Energiekonzern zukünftig knapp 80 Prozent der RWW-Anteile besitzen soll.
Damit gäbe
es keine kommunale Sperrminorität mehr! In diesem Sinne könnte dieser
Fall eine Beispielfunktion bekommen, die bei Zulassung des Geschäfts eine
rechtliche Barriere niederreißen würde, nämlich den Paragraph 103
GWB, der erst kürzlich vom deutschen Parlament bestätigt worden war.
„Die Konzernchefs wollen auf eine gesetzlich legitimierte Marktöffnung
nicht mehr warten. Es geht eben auch ohne, durch Zukäufe und Beteiligungen“,
wie es Dietmar Student treffend im Manager-Magazin vom Januar 2002 beschreibt.
Da der Berliner Klüngel dem im Ruhrgebiet sicherlich in nichts nachsteht,
sollte der Verkaufsvertrag der Berlinwasser einer eingehenden Überprüfung
unterzogen werden.
 zurück zurück
Monopol auf dem Wassermarkt von Hermann Werle. Veröffentlicht in MieterEcho
(Zeitung der Berliner MieterGemeinschaft) Mai 2002 / Nr. 290  www.bmg.ipn.de www.bmg.ipn.de |
 |
 |